"Ich bin Pflegefachmann mit Masterabschluss"
So und genau so stelle ich mich vor - bei pflegewissenschaftlichen Praxisbegleitungen im Klinikum Ernst von Bergmann, auf Podien bei politischen Diskussionen, in Fachgremien und natürlich gegenüber Patient:innen, die sich mit meinem Jobtitel „klinisch tätiger Pflegewissenschaftler“ verständlicherweise schwertun. Es ist der Pflegeberuf, der mich in meinem beruflichen Tun definiert. Das Studium baut darauf auf.
Als ich nach meiner Ausbildung meinen ersten Job im Krankenhaus antrat, dauerte es nicht lang und ich stellte mir immer mehr Warum-Fragen:
- Warum stellen wir Medikamente im Nachtdienst allein für alle Patient:innen, wenn man sich so schlecht konzentrieren kann?
- Warum müssen wir so viel mehr Patient:innen versorgen als Pflegefachpersonen in anderen Ländern?
- Warum nennen wir das „interdisziplinäre Fallkonferenz“, wenn eine Oberärztin wöchentlich dieselben standardisierten Phrasen in ein Diktiergerät spricht und die Rolle der Therapeut:innen und Pflegefachpersonen lediglich darin besteht, einzelne Aussagen via Kopfbewegung zu bestätigen oder zu verneinen?
Niemand aus meinem Team konnte oder wollte mir auf solche Fragen zufriedenstellend antworten. Mir wurde bald klar: Um in und für den Pflegeberuf etwas verändern zu können, muss ich das System im Großen und im Kleinen besser verstehen. So fasste ich den Entschluss: „Ich studiere - in Vollzeit, berufsbegleitend“. Womit ich damals überhaupt nicht rechnete und was mich in Folge stärker bewegte, als ich mir das lange eingestehen wollte: Die Entscheidung für das Studium führte zum Bruch mit meinem Team. Zu Beginn bekam ich das noch eher subtil und unterschwellig zu spüren: Wenn ich beispielsweise den Aufenthaltsraum betrat und Gespräche abrupt verstummten. Immer wieder bekam ich dieselben halbernsten Fragen gestellt:
„Und? Was machste dann? Wirst‘ dann unser Chef, wa?“
War es leichtsinnig oder naive von mir, der Neugier nachzugehen und zu studieren, ohne mir vorher ausführlich über mögliche Konsequenzen Gedanken zu machen?

Ambitionen? Bitte woanders!
Und dann kam die Einladung zum Gespräch bei der Pflegedirektorin. Mit ehrlichem Interesse erkundigte sie sich über mein Studium. Ich fühlte mich zum ersten Mal bei diesem Thema in meinem Krankenhaus verstanden und spürte, wie der Funke einer Erwartung in mir aufzuflackern begann. Doch die kalte Dusche kam umgehend:
„Das klingt ja alles sehr interessant. Mhmm. Wir haben hier ja aber schon jemanden fürs Qualitätsmanagement.“
Von den zurückliegenden fünfzehn Minuten, in denen ich von Evidence-basierter Praxis, Kenntnissen vom Gesundheitssystem, interdisziplinärer Zusammenarbeit und vielen anderen Inhalten des Studiums sprach, hat sich anscheinend nur das Buzzword „Qualität“ verfangen. Und dafür gab es ja schon jemanden.
Ob es am Studium lag, an der damit verbundenen Arbeitszeitverkürzung oder an der Kombination aus beidem, kann ich heute nicht mehr genau sagen. Nach diesem Gespräch stellte ich jedoch fest: In mich und in meine berufliche Entwicklung wurde von nun an nicht mehr investiert. Informationen zu neuen Prozessen, Geräten, Prozeduren drangen nicht zu mir durch – lohnte sich anscheinend nicht mehr.
Ich wurde inoffiziell zum Aussteiger erklärt, obwohl mir noch im Probezeitgespräch großes Potenzial attestiert wurde. Doch mit dem Studium wurde das Verhältnis mit meinem Team immer unentspannter. Es spitzte sich immer weiter zu, sodass ich für mich keinen anderen Ausweg mehr sah, als das Krankenhaus zu verlassen. Aus dem oft bemühten Vorurteil, dass „studierte“ Pflegefachpersonen nicht mehr „am Bett“ arbeiten, wurde in meinem Fall eine selbsterfüllende Prophezeiung - vorerst.
Als APN bei der Krankenversicherung – können wir uns das leisten?
Wenn das jemand möchte, dann ist das völlig okay. Mein Wunsch oder Plan war es nicht, das Krankenhaus zu verlassen. Und ich kenne zahlreiche Kolleg:innen, die aufgrund mangelnder Offenheit für die erweiterten Kompetenzen und Perspektiven aus dem Studium und nach ähnlichen Erfahrungen am Ende notgedrungen die Praxis verließen. Jobalternativen für Pflegefachpersonen mit Hochschulabschluss gibt es zu Genüge - ob nun in der gemeinsamen Selbstverwaltung, bei Krankenkassen oder in der Forschung. Keine Frage: Ihre Arbeit dort ist wichtig. Die Perspektiven professionell Pflegender sind gemessen an unserem zahlenmäßigen Anteil in der Gesundheitsversorgung viel zu schwach in Institutionen und Gremien vertreten.
Dennoch finde ich es erschütternd, dass es in vielen Fällen eben nicht der primäre Wunsch der Kolleg:innen war, der sie aus der Patient:innenversorgung dorthin geführt hat. Es sind zu oft erlebte Vorurteilen, fehlender Offenheit und Ablehnung. Die erweiterten Kompetenzen von Bachelor– und Masterabsolvent:innen pflegepraktischer Studiengänge können sich nur dann entfalten, wenn sie in der Gesundheitsversorgung ankommen und dort zugelassen werden. Nur wenn sichtbar wird, dass Kollge:innen nach dem Studium dort einen sichtbaren, spürbaren Unterschied machen, wird sich die Bekanntheit erweiterter Rollen, aber auch die Wahrnehmung des gesamten Pflegeberufs verändern.
Die Einführung und Regulierung von APN-Rollen haben in den bspw. USA nicht nur dazu beigetragen, dass für hochkomplexe Bedarfe von Patient:innen und deren Zugehörigen maßgeschneiderte Versorgungsmodelle angeboten werden können, auch die gesellschaftliche Wahrnehmung und das Ansehen der Pflegeprofession insgesamt profitieren nachhaltig davon.
Gartenzwerg und Berufsausbildung: Deutschlands unbeirrbare Erfolgsrezepte
Für alle, die einmal die Gelegenheit hatten, sich mit Kolleg:innen aus dem Ausland über Professionalisierung und Autonomie im Pflegeberuf auszutauschen oder Pflege in anderen Ländern hautnah zu erleben, wird hinterher der deutsche, intraprofessionelle Konflikt über die (Teil-)Akademisierung des Pflegeberufs völlig absurd vorkommen. Während in nahezu allen Ländern ein Bachelorabschluss den Zugang zum Pflegeberuf eröffnet, halten wir in Deutschland dogmatisch an unserer Berufsausbildung fest. Die Deutsche Berufsausbildung ist schließlich ein Exportschlager wie Verbrennerautos, Brotkultur und Gartenzwerge. Und tatsächlich haben deutsche Unternehmen wie Daimler, Volkswagen oder BMW in einigen ihrer amerikanischen und asiatischen Werke mit großem Erfolg eine Art duale Ausbildung nach deutschem Vorbild für ihre Industriearbeiter:innen eingeführt.
Der Erfolg erklärt sich vor allem dadurch, dass die Belegschaft bis dato überwiegend aus „ungelernten“ oder „angelernten“ Arbeiter:innen bestand. Es sollte also wenig überraschen, dass Absolvent:innen einer Art dreijährigen Berufsausbildung im Vergleich zu Ungelernten hinsichtlich ihrer Fertigkeiten und Kompetenzen hervorstechen. Im Pflegeberuf tritt unsere generalistische Berufsausbildung im internationalen Wettstreit allerdings gegen in der Regel vierjährige, universitäre Bachelorprogramme an, auf die ein praktisches (bezahltes) Orientierungsjahr folgt.
Ich kann und möchte an dieser Stelle nicht vorenthalten, dass seit der letzten Reform hin zur Generalistik auch die Berufsausbildung in der Pflege von Kolleg:innen durchaus kritisch betrachtet wird. Die Tatsache, dass Auszubildende heute in Fachabteilungen geschickt werden, ohne vorher deren medizinische Hauptdiagnosen auswendig gelernt zu haben, wird ebenso als qualitativer Rückschritt betrachtet, wie der vergleichsweise hohe Anteil an Praxisstunden in der Langzeitversorgung. Und nicht nur die Pädiater:innen, sondern auch viel zu viele berufserfahrene Kolleg:innen trauern bei jeder sich bietenden Gelegenheit öffentlichkeitswirksam der guten alten Kinderkrankenpflegeausbildung hinterher. Es wird wohl noch einige Zeit vergehen, bevor aus drei Pflegeberufen tatsächlich einer geworden sein wird. Nichts desto trotz erfahren selbst die Auszubildenden der Generalistik immer noch mehr Akzeptanz bei Kolleg:innen als diejenigen, die sich für ein primärqualifizierendes Pflegestudium entschieden haben.
Wir sind alle gleich! Zumindest fast.
Wenn Pflegefachpersonen heute über Engagement und Eignung von Stationsleitungen und Pflegedirektor:innen urteilen, scheint immer noch ein wichtiger Maßstab zu sein, ob und in welchem Umfang im Ernstfall in der direkten Patient:innenversorgung ausgeholfen wird – je mehr, desto besser. Ob das mittel- bis langfristig für die Organisation klug und gut ist, scheint bei dieser Beurteilung erstmal keine Rolle zu spielen.
Ich habe Pflegemanager:innen, -pädagog:innen und -wissenschaftler:innen in US-amerikanischen Krankenhäusern getroffen. Im Gespräch mit ihnen über ihre spannenden Rollen sind mir zwei Aspekte ganz besonders aufgefallen:
- Diese Spezialisierungen zählen zweifelsfrei und ganz selbstverständlich zum Pflegeberuf und ihr Mehrwert, den die Rolleninhabenden für die Organisation und die Berufsgruppe bringen, wird nicht nur wahrgenommen, sondern wertgeschätzt.
- Keine:r von den Expert:innen aus der Praxis hielt es für eine besonders gute Idee, dass Pflegemanager:innen im Ernstfall in der Versorgung einspringen: Sowohl Bewusstsein also auch Respekt vor der starken Binnenspezialisierung im Pflegeberuf war bei den Kolleg:innen stärker ausgeprägt als in Deutschland.
In englischsprachigen Ländern stehen die vielen Abkürzungen hinter dem Namen von Pflegefachpersonen oft für akademische, praxisnahe Weiterbildungen und Spezialisierungen, die mit mehr Eigenständigkeit und Verantwortung verbunden sind. In Deutschland hingegen spielt es bisher kaum eine Rolle für die Autonomie oder Zuständigkeit, ob ich eine Fachweiterbildung wie bspw. in der Intensivpflege, Onkologie, Notfallpflege, Psychiatrie oder im Wundmanagement abgeschlossen habe oder nicht.
Pflege in Deutschland kannte bis zur letzten Pflegeberufereform und dem Pflegestudiumstärkungsgesetz keine fachliche Binnendifferenzierung. Das, was uns bisher wie erweiterte Kompetenzen vorkommt, findet am Ende doch wieder auf Ebene ärztlicher Delegation statt und kann mit einem Wechsel in der medizinischen Leitung problemlos rückabgewickelt werden.
Vor kurzem habe ich von einer bedenkenswerten Initiative Pflegestudierender gehört, die sich gewerkschaftlich dafür einsetzen, dass Pflegestudierende nicht höher vergütet werden als Pflegeauszubildende. „Schließlich machen wir die gleiche Arbeit.“ Spannend! Mit dem Pflegeberufegesetz (Teil III) als Backup fällt es relativ leicht, dagegen zu argumentieren. Doch das tut am Ende nichts zur Sache, wenn diese gesetzlichen Regelungen und Ziele in der erlebten Praxis nicht ankommen, weil sich niemand dafür einsetzt. Jetzt mal Hand aufs Herz: Muten wir primärqualifizierend Studierenden in der Pioniergeneration da nicht vielleicht ein bisschen viel zu?
Kann man ihnen vorwerfen, in die altbewährte Gleichmacherei der deutschen Pflege zu verfallen, statt sich für eine bessere, an den Zielen der hochschulischen Pflegeausbildung ausgerichteten praktischen Ausbildung einzusetzen und letztendlich als Noviz:innen Konflikte à la „Du hältst dich also für etwas Besseres?“ auszuhalten? Nein!
Mehr Intraprofessionelle Multidisziplinarität - dann klappt’s auch mit den Nachbarn
Ich möchte dazu ermutigen Quali(fikations)mix in der Pflege größer zu denken. Die aktuell vorherrschende Diskussion hierzu, die stark aus der Perspektive des Pflegefachassistenzgesetzes geführt wird, ist mir zu kleinteilig. Als ich anfing, mich konzeptionell mit einer kompetenzorientierten Aufgabenverteilung auseinanderzusetzen, bin ich immer wieder auf Quellen gestoßen, in denen diskutiert wurde, dass besser qualifizierte Pflegefachpersonen auch mehr Verantwortung übernehmen können. Von da aus bin ich dann ins Rabbit Hole der Arztentlastung gestürzt… Mir kamen allerdings Zweifel auf:
„Ist das in unserer aktuellen Situation des Pflegepersonalmangels überhaupt sinnvoll?“
Doch das war die völlig falsche Frage! Warum betrachten wir die Versorgung von Patient:innen allein aus der Perspektive einer einzigen privilegierten Berufsgruppe. Wir als Advokat:innen einer ganzheitlichen, Person-zentrierten Versorgung lassen uns bei der unreflektierten Übernahme solcher Vokabeln an der Nase herumführen. Denn eigentlich sollte es uns allen um bestmögliche Versorgungsqualität und -kontinuität gehen. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, hat man plötzlich überlappende Kompetenzbereiche statt Silos und es scheint nicht nur sinnvoll, sondern unabdingbar, dass qualifizierte Pflegefachpersonen mehr Befugnisse bspw. in der Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes erhalten - nicht um eine andere Berufsgruppe zu entlasten, sondern um das eigene Potenzial zum Nutzen der Betroffenen zu entfalten. Denn Pflege hat unglaublich viel zu bieten - von individueller Beratung und Schulung zu bspw. Lebensstilinterventionen und Selbstmanagement über psychosoziale Unterstützung, Förderung von Gesundheitskompetenz, Einbeziehung des sozialen Umfelds, Förderung von Autonomie, Prävention und Früherkennung von Komplikationen, Koordinierung der interdisziplinären Zusammenarbeit bis hin zur (Weiter-) Entwicklung eines individuellen Behandlungsplans. Das alles ist Pflegekompetenz. Die Basis dafür wird in und mit der dreijährigen Berufsausbildung gelegt. Doch wenn man die stetig wachsenden Herausforderungen in der pflegerisch-gesundheitlichen Versorgung betrachtet, wird schnell klar, dass damit nicht Schluss sein kann. Die medizintechnischen, pharmakologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben dazu geführt, dass man heute trotz Multimorbidität ein langes, selbstbestimmtes Leben führen kann. Doch um diesen steigenden Anforderungen weiterhin gerecht werden zu können, benötigt Pflege Spezialisierungsmöglichkeiten mit mehr Kompetenzen – auch leistungsrechtlich.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass erweiterte hochschulisch qualifizierte Rollen in der Pflege in Versorgungssituationen auf Akzeptanz stoßen, wenn es gelingt, ihren Wert für eine ganzheitliche und Personen-zentrierte Versorgung klar zu vermitteln und der Mehrwert für alle Beteiligten deutlich ist.
Hart oder extrahart?
Der Anteil der hochschulisch qualifizierten Pflegefachpersonen in der Versorgungspraxis ist immer noch verschwindend gering. Stell dir vor, du bist eine:r der wenigen Exemplare: Die meisten deiner Kolleg:innen werden weder vom primärqualifizierenden Studium, noch von Advanced Nursing Practice gehört haben – geschweige denn persönliche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit solchen Kompetenzprofilen gesammelt haben. Du gehörst also zur Pioniergeneration. Herzlichen Glückwunsch!
Du bist innovativ, mutig, hartnäckig, lösungsorientiert, visionär. Du bist ein Vorbild! Fühlt sich gemütlich an, oder? Ich will dir nichts vormachen:
Wenn du Pflegefachperson mit Bachelor- oder Masterabschluss bist und deine erweiterten Kompetenzen anwenden möchtest, hast du die Wahl, ob du täglich deine Pionier-Superkräfte einsetzt, um Veränderung in deiner Organisation und Akzeptanz deiner Rolle gegen alle intra- und interprofessionellen Widerstände voranzutreiben oder ob du Erfahrung in einer Organisation sammeln möchtest, in der Voraussetzungen herrschen, die dir die Ausübung deiner Rolle erleichtern, dich unterstützen.
Es gibt allgemeine Faktoren, die sich auf die Implementierung neuer Rollen positiv auswirken. Vieles kennen wir aus der Implementierungsforschung wie kulturelle Rahmenbedingungen und Werte, die in der Organisation geteilt werden. Solche Organisationen erkennst du bspw. daran, dass…
- es für die Rollen konkrete Profile gibt,
- es Kolleg:innen in der Organisation gibt, die sich in eine solche Rollen weiterentwickelt haben und dabei unterstützt wurden,
- es Organisationsziele gibt, die die Implementierung erweiterter pflegerischer Rollen beinhalten oder unterstützen,
- es eine unterstützende Aufbaustruktur gibt wie bspw. eine Abteilung für Pflege- oder Praxisentwicklung.
Teste das gemeinsame Verständnis beim Kennenlerngespräch, inwiefern die wohlklingenden Worte aus der Stellenbeschreibung konzeptionell von deinem Gegenüber auch verinnerlicht wurden.
Pflegeakademisierung in Deutschland: Meilen- oder Stolpersteine
Die Akademisierung der Pflege begann in Deutschland vergleichsweise spät und verlief ganz anders als in den meisten Ländern. Während etwa in Kanada, den USA oder in den skandinavischen Ländern frühzeitig der Fokus darauf lag, Pflegefachpersonen an Hochschulen und Universitäten für die Versorgungspraxis zu qualifizieren, wurde in Deutschland die Akademisierung zunächst auf die Spezialisierungen Forschung, Management und Lehre beschränkt. Der Gedanke war, dass von diesen Multiplikator:innen ausgehend die gesamte Berufsgruppe mitgezogen würde. Ob das nun eine Fehleinschätzung war oder schließlich Jahrzehnte später doch mit dem primärqualifizierenden Pflegestudium gelungen ist, soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Denn für die daraus resultierende Herausforderung macht das keinen Unterschied:
Pflegefachpersonen in Deutschland machten die Erfahrung, dass das Studium der Pflege eben nicht mit erweiterten Kompetenzen zurück in die Praxis führt, sondern in Arbeitsfelder, in denen man nicht von Schichtarbeit, Wochenenddiensten, Infektionsrisiko, körperlicher Anstrengung oder seelisch anspruchsvoller Beziehungsarbeit betroffen ist und dennoch finanziell recht gut davon leben kann.
Um 2010 herum gingen dann allerdings die ersten Modellstudiengänge für die pflegerische Praxis an den Start. Studierende erhielten in diesen Programmen nach drei Jahren die Berufsurkunde und nach dem siebten Semester wurde das Studium dann üblicherweise mit einem Bachelorabschluss beendet. Ihr Berufseinstieg erfolgte allerdings in ein System, das Krankenhäuser für möglichst viele komplexe Eingriffe bei minimalen Pflegekosten belohnte. Weder erweiterte Kompetenzen, noch Rollenprofile waren gesetzlich geregelt. Es fehlten nicht nur an Motivation, sondern auch an Strategien zur Integration neuester pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. In der Folge wurde das Potenzial hochschulisch qualifizierter Pflegefachpersonen in der deutschen Versorgungspraxis weiterhin kaum genutzt.
Die Folge: Vorurteile wie „Wer studiert, arbeitet nicht am Patienten“ oder „Die haben keinen Bezug zur Realität“ verstärkten die Kluft zwischen akademisierter und berufliche ausgebildeten Pflegefachpersonen.
Deutschland tickt anders
Na gut…. Österreich vielleicht auch. Ich hoffe, dass es mir bis hierhin die Darstellung möglicher Hintergründe gelungen ist, weshalb wir mit den Konzepten anderer Länder hier nicht weiterkommen. Wir haben es in Deutschland inzwischen nicht nur mit Unkenntnis, sondern mit teilweise manifestierten Vorurteilen bzgl. hochschulisch qualifizierter Pflegefachpersonen zu tun. Wenn wir wollen, dass die (Teil-)Akademisierung der deutschen Pflegepraxis mit all ihren Verheißungen gelingt, müssen wir denen auf den Grund gehen und die gewonnenen Erkenntnisse in entsprechenden Implementierungsstrategien berücksichtigen.
Seit dem 1. Dezember gehen wir diesem Thema im Klinikum Ernst von Bergmann gemeinsam mit Kolleg:innen von der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe im Projekt Kooperative Neugestaltung für Akzeptanz im Team (KoNtAkT) wissenschaftlich nach. Wir werden bereits im Laufe des Projekts Zwischenergebnisse berichten und diskutierten.
Acht Jahre hat es bei mir gedauert, bis ich nach meinem Bruch mit der Pflegepraxis einen Job gefunden habe, der es mir ermöglicht, Wissenschaft mit direktem Patient:innenzugang zu vereinen.
Zwischendurch war ich mir nicht sicher, ob es mir das noch mal gelingen wird.
Ich habe daraus Motivation geschöpft, mich in meiner beruflichen Rolle im Klinikum Ernst von Bergmann, politisch beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, aber auch wissenschaftlich diesem Thema zu widmen.
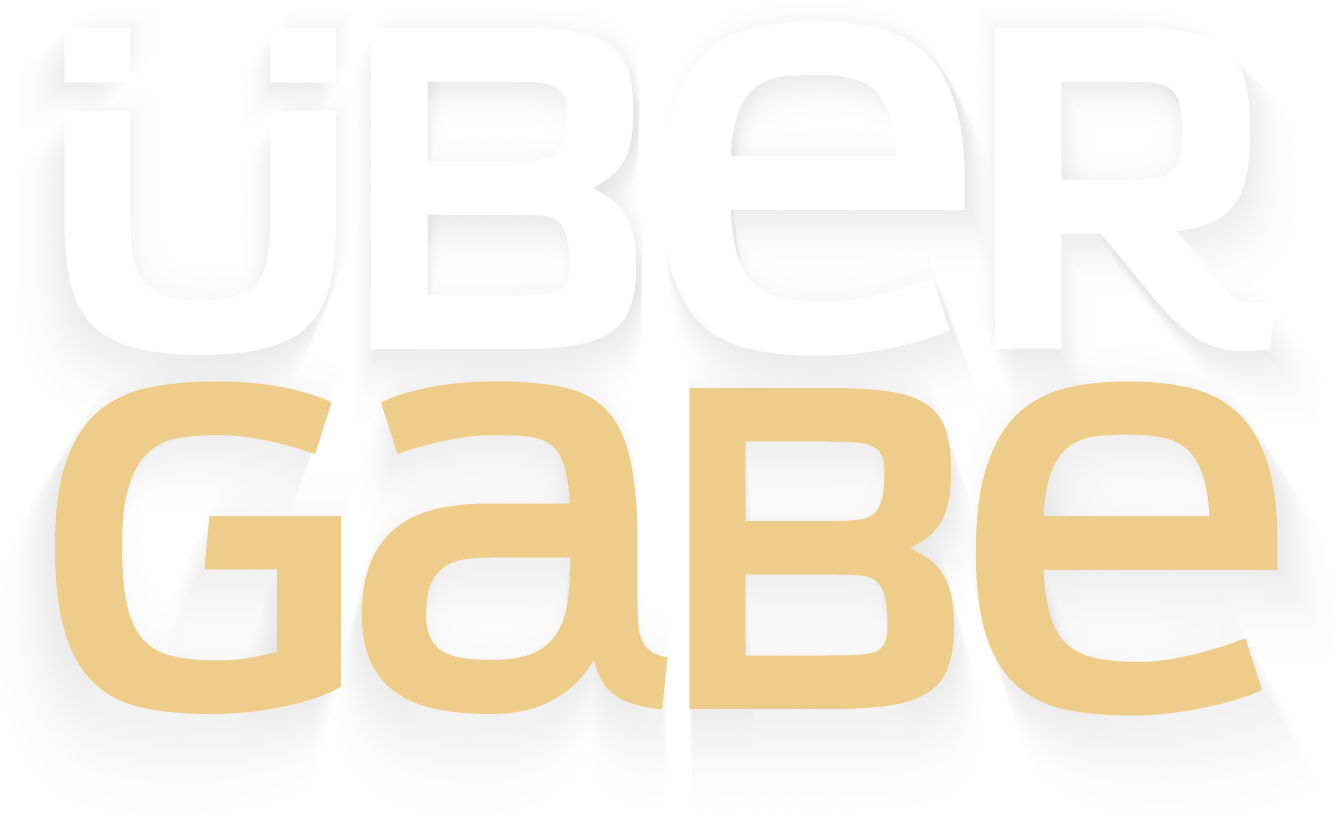


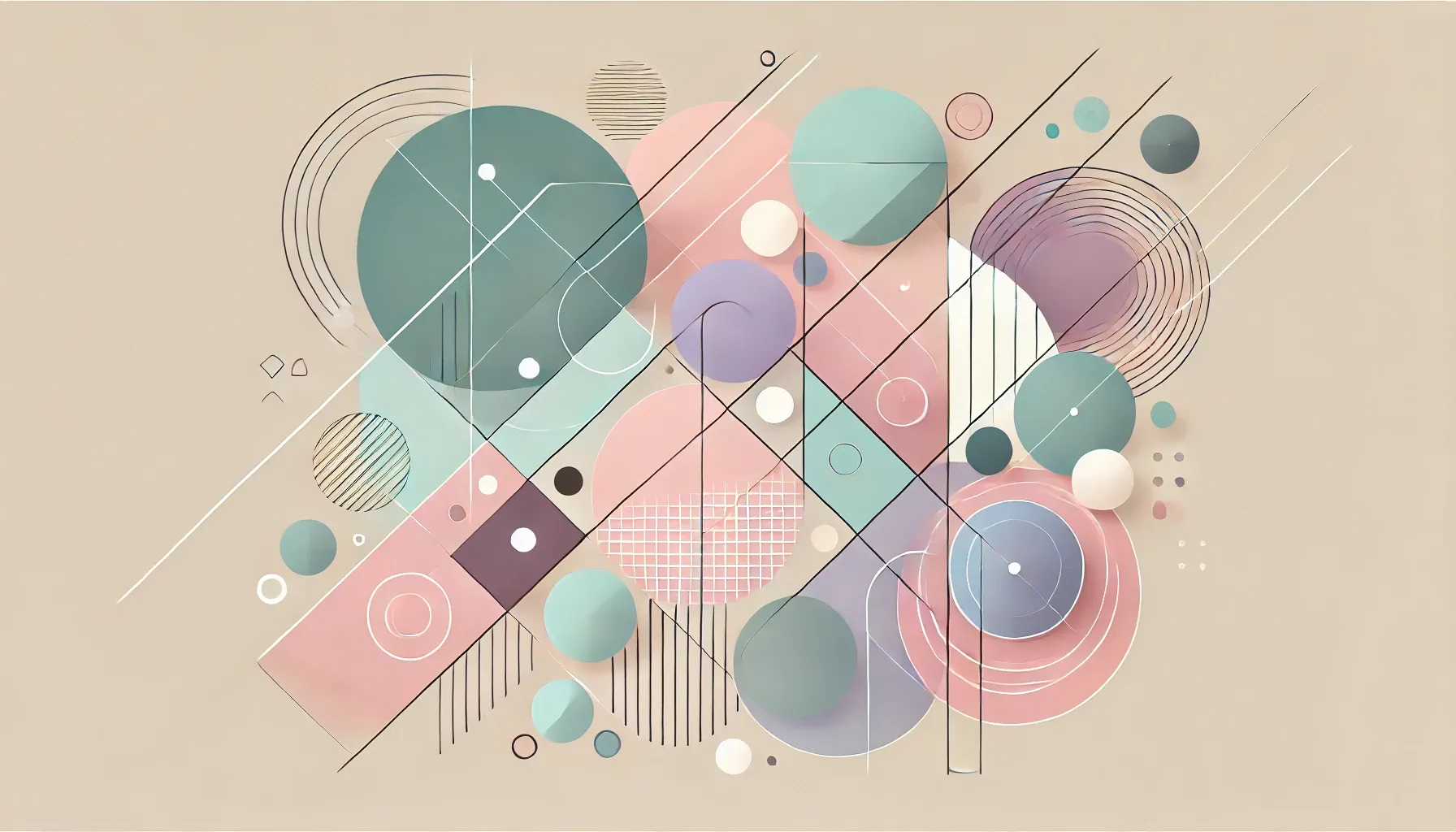

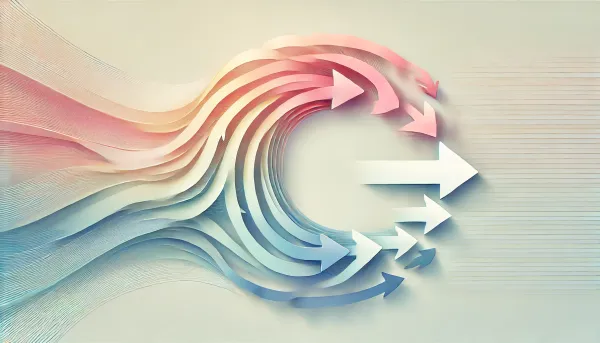

Diskussion