Einleitung
Die Pflegebranche steht nicht nur vor kommenden großen Herausforderungen – nein, sie findet sich derzeit schon mitten in vielerlei Herausforderungen wieder. Eine älter werdende Gesellschaft, älter werdende Mitarbeiter:innen in der Pflege, Fachkräfte, deren Zahl weniger wird und in die Interaktionsarbeit Pflege einziehende Digitalisierung bedeuten große Wandlungen mit ihren je eigenen Herausforderungen. Aber auch Chancen können aus diesen großen Herausforderungen entstehen. Der eine oder die andere mag sich nun fragen: „Chancen – welche Chancen?“ und angesichts der großen Herausforderungen, die das Berufsfeld Pflege verändern, kann dieser Blickwinkel durchaus Berechtigung finden. Andererseits bieten die genannten Herausforderungen in ihrer Umfasstheit auch die Chance, neu zu denken, neu zu handeln und vor allem aktiv zu gestalten, um das Berufsfeld Pflege zukünftig anders aufzustellen. Denn auf Grund des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und der zunehmenden Digitalisierung ist es schon heute entscheidend, zukunftsorientierte Ansätze zu entwickeln und neue Wege zu gehen. Und hier liegen durchaus einige Gestaltungsmöglichkeiten, denn die gute Nachricht ist: Es gibt nicht nur den einen Weg, sondern viele. In diesem Beitrag soll es darum gehen, andere Zukünfte der Pflegebranche in den Blick zu nehmen und Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen, die durch den Einsatz von Methoden der Zukunftsforschung entstehen können.

1. Pflege im Wandel – aber wohin?
Die Pflegebranche ist derzeit durch große Herausforderungen gekennzeichnet, die auf sie einwirken. Exemplarisch seien hier genannt: demografischer Wandel, Fachkräftemangel und Digitalisierung. Der demografische Wandel hat dabei sogar noch eine zweifache Wirkung: nicht nur werden wir als Gesellschaft insgesamt durch medizinischen Fortschritt, verbesserte Ernährung und Gesundheitsvorsorge immer älter, sondern auch die Pflege-Fachkräfte selbst werden immer älter (1, Literaturangaben s. Ende). Dies kann zusätzlich zur Folge haben, dass eine körperlich und mental anspruchsvolle Arbeit wie die Pflege nicht immer bis zum vorgesehenen Renteneintritt ausgeübt werden kann. Dies wirkt sich unmittelbar auf den nächsten hier benannten Treiber aus und verstärkt diesen: der Fachkräftemangel. Schon heute besteht in der Pflegebranche ein eklatanter Mangel an Fachkräften (2). Der nach bisherigen Zahlen vorliegende Bedarf an Fachkräften könnte sich laut Statistischem Bundesamt bis zum Jahr 2049 um ein Drittel auf 2,19 Millionen steigern im Vergleich zu 2019 (3). Das heißt: in Zukunft ist damit zu rechnen, dass der Bedarf den zur Verfügung stehenden Pool an Fachkräften weit übersteigen wird. Dies ist keine angenehme Zukunftsaussicht. Auf Grund von demografischem Wandel und Fachkräftemangel rückt damit der (zunehmende) Einsatz von Digitalisierung in den Blick als mögliche Lösungsoption für die herrschenden Probleme in der Pflegebranche. Als eine mögliche Lösung werden digitale Tools und der Einsatz von digitalen Unterstützungslösungen für die Pflege diskutiert. Dabei ist der Fokus auf die Unterstützung und Erleichterung der Pflegearbeit gerichtet, so dass Pflegepersonen mehr Zeit gewinnen können. Das aus dem Wirtschaftskontext übertragene Wort „gewinnen“ ist dabei bewusst gewählt, da auch die Pflegebranche seit langem eine Ökonomisierungsbewegung durchläuft. Gewonnen wird dann durch den Einsatz digitaler (Unterstützungs-) Anwendungen – so die allgemeine Hoffnung – ein Mehr an Zeit für Pflegekräfte. Allerdings bedeutet dieses „Mehr an Zeit“ nicht unbedingt, dass auch ein Mehr an Zeit für Interaktionsarbeit und den einzelnen Pflegeempfangenden dabei herauskommt oder die „gewonnene Zeit“ für Weiterbildung von professionell Pflegenden eingesetzt wird. Die erwartete Situation des Fachkräftemangels wird in dieser Logik überhaupt erst bewältigbar durch den Einsatz von Digitalisierung, um das erwartete erhöhte Aufkommenden pflegebedürftiger Menschen bewältigen zu können. Schlussendlich wären also Pflegekräfte durch ein „Mehr an Zeit“ mit einem „Mehr an Patienten in der zur Verfügung stehenden Zeit“ konfrontiert. Dies würde dann also nicht zu verbesserten Arbeitsbedingungen und zu einer höheren Attraktivität des Pflegeberufes führen, die es dringend braucht.
Dies ist allerdings nur eine von vielen Möglichkeiten wie eine Pflege der Zukunft aufgestellt sein könnte. Eine zugegeben weit verbreitete Erzählung, die einen defizitären Blick auf die Branche Pflege und die in ihr arbeitenden Menschen unterstützt und den vermehrten Einsatz von Digitalisierung quasi als unausweichlich erscheinen lässt. Digitalisierung bzw. Technisierung verengt den Blick aber darauf, dass nur Technik als Lösung zur Bewältigung der anstehenden Probleme gesehen wird. Was aber wäre, wenn es weitere Möglichkeiten für eine andere Gestaltung der Zukunft der Pflege geben kann? Was wäre, wenn nicht nur der Einsatz von Technik das System Pflege gestalten kann, sondern auch die Menschen, die in der Pflege arbeiten, das System Pflege wünschbar gestalten können? Für dieses Gedankenspiel kann die Disziplin Zukunftsforschung mit ihren Methoden einen Ansatzpunkt liefern.
2. Zukunftsforschung als Grundlage für Zukunftsgestaltung
Die Disziplin Zukunftsforschung befasst sich auf den ersten Blick mit etwas, was es noch gar nicht gibt: der Zukunft. Wobei da schon der Hase im Pfeffer liegt, denn in der Zukunftsforschung spricht man von Zukünften, gerne ohne Artikel und nicht von „der Zukunft“. Der (sehr) menschliche Wunsch, über „die Zukunft“ Bescheid zu wissen, ja im Besonderen über die eigene Zukunft Bescheid zu wissen, ist vermutlich aus dem Wunsch des „Vorauswissen-Wollens“ vor langer Zeit entstanden. Wie im alten Griechenland wurde dieses Bedürfnis beispielsweise von Weisen (wie dem Orakel von Delphi) bedient. Diese Beschäftigung mit Zukunft war noch weitgehend von Spekulation geprägt. Im Laufe der Zeit wandelte sich die Befassung mit Zukunft zu einer systematischeren Beschäftigung mittels Methoden der Berechnung. Die Vorausschau war gegründet auf den technischen Fortschritt, so dass auch „die Zukunft“ vorhersehbar durch den Einsatz von Technik erschien. In einer zunehmend komplexeren Welt hat sich die Disziplin Zukunftsforschung weiterentwickelt. Heute werden in der Zukunftsforschung nicht nur eine technisch begründete Vorausschau, sondern auch partizipative und kreative Methoden eingesetzt.
Die Zukunftsforschung geht grundsätzlich davon aus, dass Zukunft nicht gewusst werden kann und daher nicht feststeht (4). Dieses „Nicht-Feststehen“ gibt Raum, denn wenn etwas nicht feststeht, dann ist es offen. Offen für Gestaltung. Aber wie kann man sich der Gestaltung nicht nur einer, sondern gleich mehrerer Zukünfte nähern? Hierfür hält die Zukunftsforschung verschiedene Methoden bereit. Durch diese können verschiedene Zukunfts-Szenarien erarbeitet und sichtbar gemacht werden. Diese Zukunfts-Szenarien können dann bei Bedarf noch verschieden kategorisiert werden, beispielsweise als „plausibel“, „möglich“ oder auch „wünschenswert“.
3. Wünschbare Zukünfte in der Pflege – nur ein Gedankenspiel?
Vielleicht fragt sich nun manch Lesende: Warum sich als Individuum oder als Organisation mit wünschbaren Zukünften beschäftigen? Wir sind hier ja nicht, um es salopp zu sagen, bei „Wünsch dir was“. Und tatsächlich: Die Beschäftigung mit Zukünften, zumal noch wünschbaren, ist vielleicht nicht das Alltäglichste, besonders nicht für die Branche Pflege. Aber allein die Beschäftigung mit dem Thema „Zukunft in der Pflege“ im Plural, nämlich „Zukünfte in der Pflege“ bedeutet ein Weiten des Blickwinkels und mehr Zukunftsoptionen als bisher vielleicht geglaubt, können sichtbarer werden und Mut zum Gestalten geben. Das aktive Gestalten einer wünschbaren Zukunft ist besonders wertvoll für eine Branche, die sich derart im Umbruch befindet wie die Pflege in all ihrer Vielschichtigkeit. Das Beschäftigen mit Zukünften und die Entwicklung eines positiven, wünschbaren Zukunftsbildes kann für Pflege-Unternehmen wie eine Art „Leitstern“ wirken, um Entwicklungen hin zu dieser wünschenswerten Zukunft anzustoßen. Denn – auch das sei zu bedenken gegeben – wer sich nicht aktiv mit eigenen Zukünften beschäftigt und diese reflektiert, folgt den Zukunftsbildern, die andere für Unternehmen oder die Branche vorsehen und richtet sein Handeln daran aus, statt eigene Zukunftsbilder zu kreieren (5). Es braucht daher eigene Vorstellungen von Zukünften, um ins aktive Handeln zu kommen.
Zusätzlich kann die Beschäftigung mit wünschbaren Zukünften der Pflege auch bei Menschen, die in dieser Branche arbeiten, einen Prozess in Gang setzen, sich mit dem auseinander zu setzen, was sie an ihrer Arbeit für unverzichtbar halten oder was sich als ggf. nicht so wichtig erachten (6). Angesichts von Ökonomisierung und einer sich verändernden Arbeitswelt kann die Beschäftigung mit wünschbaren Zukünften also dazu beitragen, sich mit der Essenz von Pflegearbeit auseinander zu setzen. Beispielsweise kann auf individueller, Team- oder organisationaler Ebene reflektiert werden: Was macht für mich/uns Pflege aus und was möchten wir in einer sich ändernden Arbeitswelt erhalten oder sogar stärken? Kurz: Was macht für mich/uns eine wünschbare Zukunft der Pflege aus? Sich diesen Fragen strukturiert und methodisch zu nähern, kann dabei helfen, wünschenswerte Zukünfte der Pflege zu entwickeln.
4. Zukunftsforschungsmethoden nutzen für wünschbare Zukünfte in der Pflege
Die Zukunftsforschung verfügt über verschiedene Methoden, sich mit Zukünften zu beschäftigen und sich diesen zu nähern. Bekannt sind u.a. die Methoden Trend-Analyse und Szenario-Technik (7). Diese Methoden können mittels wissenschaftlich geleiteter Datenerhebung und -auswertung dazu beitragen, Trends zu identifizieren und daraus folgend Szenarien zu erstellen. Das ist für einen Einstieg ins „Zukünftedenken“ für Nicht-Wissenschaftler ein eher abstraktes Level. Es ist aber auch möglich, diese Methoden in einem partizipativ-kreativen Ansatz quasi „für Einsteiger“ nutzbar zu machen und in das Thema Zukünfte-Bildung einzusteigen. Diesen partizipativ-kreativen Ansatz möchte ich hier beleuchten, um aufzuzeigen, wie sich Zukünfte „erdenken“ lassen und wie sich daraus folgend eine Kategorisierung in z.B. wünschbare Zukünfte der Pflege angehen lässt.
In einem Drei-Schritt sollen 1. (Branchen-)Trends identifiziert, 2. Szenarien erstellt und 3. Szenarien kategorisiert werden. Im Folgenden stelle ich das Vorgehen exemplarisch vor. Für einen praktischen Einstieg in dieses vielleicht ungewohnte Feld der Vorausschau, von Zukünften und das Ausprobieren eignen sich die in den Quellen hinterlegten Toolkits „Trend-Analyse für Einsteiger“ (8) und „Szenario-Entwicklung für Einsteiger“ (9). Nachdem Trends identifiziert und Szenarien entwickelt wurden, können diese noch kategorisiert werden, bspw. in „möglich“, „nicht-möglich“, „wünschbar“ oder auch „nicht-wünschbar“. Angelehnt ist diese Kategorisierung an den „Futures Cone“ nach Joseph Voros (10), der davon ausgeht, dass heutige Entwicklungen in die Zukunft reichen und dort verschiedene Ausprägungen wie plausibel, möglich und wünschenswert annehmen können. Mithilfe der Trend-Analyse können – beispielsweise bezogen auf eine bestimmte Branche – Veränderungsanzeichen sichtbar gemacht werden. Hierbei geht es darum, gezielt einen genauen Blick auf das „Jetzt schon“ zu werfen und Entwicklungen, die die Branche heute schon deutlich beeinflussen und verändern, zu sammeln und zu analysieren. Dies kann beispielsweise durch die systematische Betrachtung verschiedener Einflüsse aus dem Umfeld geschehen. Einflüsse aus dem Umfeld können dabei z.B. nach politischen, wirtschaftlichen, sozialen, technologischen, umweltbezogenen und rechtlichen Einflüssen gegliedert werden (11). Oft stellen sich dann mehrere Trends dar, die sich ggf. auch gegenseitig beeinflussen können. Die Trend-Analyse dient dazu, bereits heute relevante Veränderungen eines Systems sichtbar zu machen und mögliche Auswirkungen dieser Trends in einem bestimmten Zeithorizont zu antizipieren. Das Vorausdenken von möglichen Auswirkungen der verschiedenen identifizierten Trends kann dazu beitragen, sich Zukünfte besser vorstellen zu können. Dabei geht es nicht darum, eine bestimmte Zukunft vorauszusagen, sondern im Gegenteil sich der Vielschichtigkeit von Auswirkungen bewusst zu werden. Mithilfe einer weiteren Methode können die identifizierten Trends dann in Szenarien skizziert werden („Szenario-Methode“). Wie geschieht das? Die zuvor identifizierten Trends werden danach bewertet, wie sehr sie voraussichtlich eine zukünftige Entwicklung „treiben werden“. Man bezeichnet sie deshalb auch als Treiber, denn sie beeinflussen maßgeblich, wie eine Zukunft unter diesem Treiber aussehen könnte. Eingeordnet werden diese beiden Treiber anhand der Kriterien „Ungewissheit“ und „Bedeutung“ entlang von Achsen. Leitfragen für diesen Schritt sind: „Wie gewiss/ungewiss wird dieser Treiber in Zukunft eintreten bzw. sich weiterentwickeln und zukünftige Entwicklungen beeinflussen?“ und „Wie bedeutend (stark/weniger stark) wird dieser Treiber die Zukunft beeinflussen?“. Zur Visualisierung können die identifizierten Treiber in ein Schema eingeordnet werden (s. Abb. 1). Die Treiber, die in der rechten oberen Ecke ganz außen einsortiert werden, sind die, von denen zu erwarten ist, dass sie die größte Auswirkung in Zukunft haben werden. Die Einsortierung erfolgt hier in einer diskursiven Bewertung: Wie groß wird der Einfluss des Treibers eingeschätzt? Ziel dieses Schrittes ist die Auswahl von zwei Treibern, um auf diesen aufbauend verschiedene Zukünfte skizzieren zu können.
Im nächsten Schritt werden die zwei „Top-Treiber“ dazu genutzt, Szenarien zu skizzieren. Dazu werden die beiden ausgewählten Treiber in einer 2x2 Matrix in ihren Ausprägungen (extrem bis moderat) dargestellt. Hier geht es darum, die sich gegenseitig beeinflussenden Treiber in verschiedenen Ausprägungen miteinander zu kombinieren. Dadurch können wechselseitige Einflüsse eines Treibers auf den anderen sichtbar gemacht werden. In vier Feldern entstehen so Szenarien, die unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Das Ziel dieses Schrittes ist, unterschiedliche Szenarien in unterschiedlichen Ausprägungen sichtbar zu machen und durch Ausformulierungen zu „unterfüttern“ (s. Abb. 2)
Die entstandenen Szenarien können dann noch kategorisiert werden, z.B. als „wünschbar“, „möglich“ oder auch „nicht-wünschbar“. Sie geben so eine wertvolle Orientierungshilfe, um sich auf verschiedene Zukünfte einzustellen und vorzubereiten (s. Abb. 3).
Das Beschäftigen mit Zukünften und die Entwicklung eines positiven, wünschbaren Zukunftsbildes kann dabei wie eine Art „Leitstern“ wirken, um Entwicklungen hin zu dieser wünschenswerten Zukunft anzustoßen. Mögliche Leitfrage zum Anstoßen einer Entwicklung kann sein: „Was können wir heute tun, damit das wünschenswerte Szenario eintreffen kann?“.
Abschluss und Ausblick
Die Pflege befindet sich in einem großen Umbruch – bedingt durch Fachkräftemangel, Digitalisierung und Ökonomisierung. Dabei scheinen Digitalisierung und ein vermehrter Einsatz von Technik als einziger Weg in die Pflege der Zukunft. Dies lässt die Wünsche der in der Pflege Arbeitenden allerdings außen vor und wird der Vielfältigkeit von Pflege und möglichen Zukünften der Pflege nicht gerecht. Methoden der Zukunftsforschung können helfen, Zukunft als offen und gestaltbar wahrzunehmen und ins Gestalten einer wünschbaren Zukunft der Pflege zu kommen. Neben der systematischen Beschäftigung mit Zukünften kann mit dem hier beschriebenen Weg hin zu wünschbaren Zukünften auch ein neuer Weg beschritten werden: Welche Trends in der Branche Pflege sind schon heute erkennbar, welche Szenarien können daraus entwickelt werden und welche(s) dieser Szenarien wird als „wünschbar“ wahrgenommen? Diese Fragen können helfen sich in der Branche Pflege, in einem Pflege-Unternehmen oder als professionell Pflegender individuell zu vergewissern: Was möchten wir beibehalten in einer wünschenswerten Pflege der Zukunft? Was möchten wir hinter uns lassen und/oder was wollen wir anstreben? Die Beschäftigung und strukturierte Auseinandersetzung mit Zukünften bietet in einer von Umbrüchen geprägten (Arbeits-)Welt Orientierungs- und Handlungswissen zur Gestaltung einer wünschbaren Zukunft der Pflege und lenkt den Blick von der gegenwärtigen Problembetrachtung auf eine zukunftsgerichtete, gestaltungsorientierte Auseinandersetzung.
Literatur
1) Statistisches Bundesamt | WISTA | 2 | 2024, pflegearbeitsmarkt-demografischen-wandel-022024.pdf, zuletzt aufgerufen am 28.01.2025
2) Statistik der Bundesagentur für Arbeit Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt – Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich, Nürnberg, Mai 2024, verfügbar unter: Altenpflege.pdf, zuletzt aufgerufen am 28.01.2025
3) Statista: Bedarf an Pflegefachkräften, Bis 2049 werden voraussichtlich mindestens 280 000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt - Statistisches Bundesamt, zuletzt aufgerufen am 24.02.2025
4) Zukunftsforschung für die gesellschaftliche Praxis, Kreibich/IZT: IZT_AB29.pdf, zuletzt aufgerufen am 28.02.2025
5) Kleske, Corporate Foresight: Von der Zukunftsangst zum aktiven Gestalten - Johannes Kleske, zuletzt aufgerufen am 20.02.2025
6) Haltaufderheide, https://youtu.be/xbfzUtCFn14?feature=shared, zuletzt aufgerufen am 20.02.2025
7) Grundlagen und Methoden der ZuFo, methoden-zukunftsforschung_sfz-wb21.pdf, zuletzt aufgerufen am 19.02.2025
8) Trend-Analyse für Einsteiger – ein Toolkit., Toolkit-Trends-FutureImpacts-Foresight-Festival-1-2021-ff.pdf, zuletzt aufgerufen am 24.02.2025
9) Szenario-Entwicklung für Einsteiger – ein Toolkit., Toolkit-Szenarien-FutureImpacts-Foresight-Festival-1-2021-ff.pdf, zuletzt aufgerufen am 24.02.2025
10) Voros, Futures Cone, BHAnticipation-Voros-preprintofsubmittedversion.pdf, zuletzt aufgerufen am 24.02.2025
11) PESTEL, Organisationshandbuch - PESTEL-Methode, BMIH, zuletzt aufgerufen am 28.02.2025



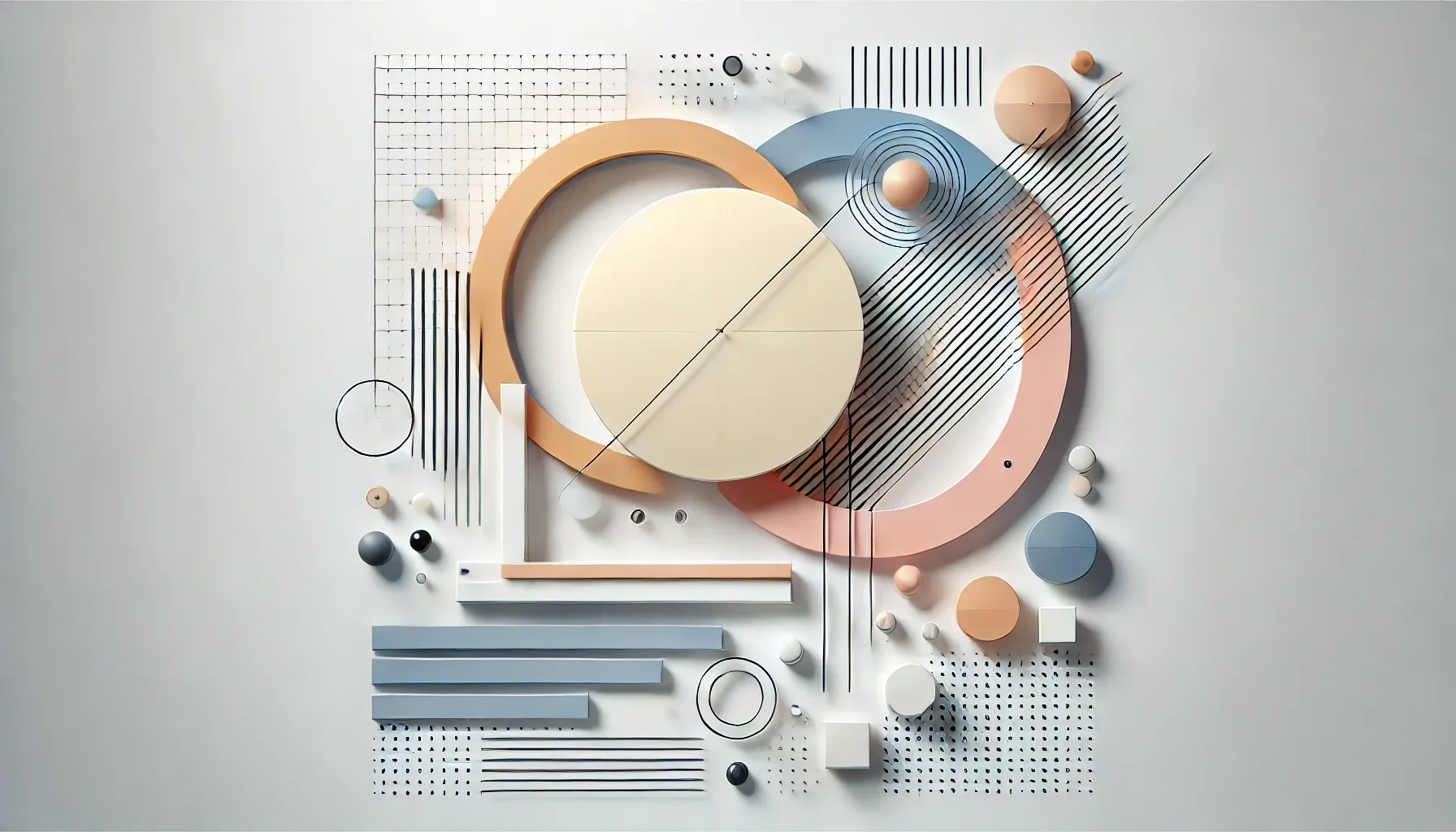
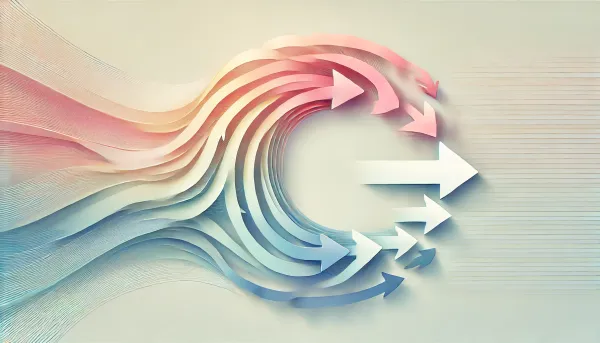

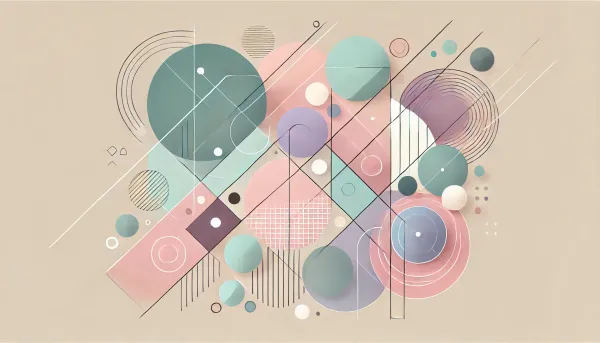
Diskussion