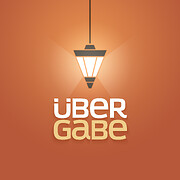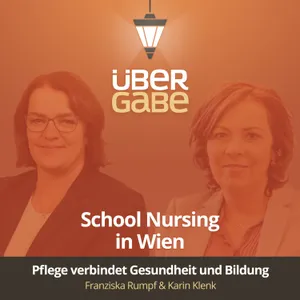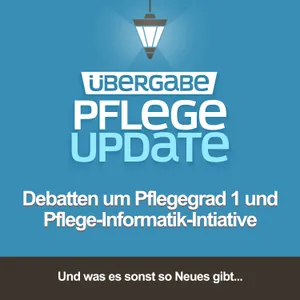Junge Pflege: Eine eigene Lebensrealität in der Versorgung
Wenn junge Menschen durch neurologische Erkrankungen pflegebedürftig werden, stellt das das Versorgungssystem vor Herausforderungen. Weder die klassische Altenpflege noch kurzfristige Reha-Maßnahmen können diesen Menschen gerecht werden. Einrichtungen, wie das Alloheim in Mönchengladbach und in Düsseldorf entwickeln seit Jahren spezialisierte Konzepte für genau diese Zielgruppe. Was genau ist „junge Pflege“? Wer lebt dort, wie sieht der Alltag aus, und was bedeutet das für Pflegefachpersonen?

Wer sind die Bewohner:innen der jungen Pflege?
Die Definition der „jungen Pflege“ orientiert sich weniger an einem Lebensgefühl, sondern konkret an Alter und Krankheitsbild: Gemeint sind pflegebedürftige Menschen zwischen 18 und 63 Jahren mit neurologischen oder physischen Einschränkungen – etwa durch Multiple Sklerose, Schädel-Hirn-Traumata, Schlaganfälle, Aneurysmen oder schwere Sportunfälle. Oft geht damit ein hoher Pflegebedarf einher, in manchen Fällen auch eine Beatmungspflicht.
Der Anstoß kam aus der Realität
Die Geschichte hinter dem Aufbau einer der ersten spezialisierten Einrichtungen beginnt mit einem Anruf: Eine Mutter fragt, ob es auch Angebote für junge pflegebedürftige Menschen gäbe – für ihren Sohn, der mit Anfang 30 an MS leidet. Diese eine Nachfrage war der Impuls, ein ganzes Versorgungskonzept zu entwickeln. Das Besondere: Es wurde eng mit dem Medizinischen Dienst entwickelt und erlaubt bis heute auch die Aufnahme beatmeter Menschen.

Alltag statt Endstation
„Heim“ – das klingt für viele nach Lebensabend, Endstation, Sterbebett. Doch in der jungen Pflege geht es oft um das Gegenteil: Rückkehr ins Leben. Bewohner:innen ziehen nicht selten wieder nach Hause, besuchen Werkstätten, feiern Geburtstage, reisen mit ihren Familien oder feiern ausgelassen in der Disco. Der Alltag ist so nah wie möglich an dem Leben, das vor der Erkrankung stattgefunden hat – nur eben mit Unterstützung.
Neue Rolle für Pflegefachpersonen
Diese besondere Form der Pflege erfordert mehr als klassische Altenpflege-Kompetenz. Hier arbeiten Pflegefachpersonen, Therapeut:innen und Sozialarbeiter:innen eng zusammen. Pflege bedeutet nicht nur Körperpflege, sondern vor allem Alltagsgestaltung, psychosoziale Begleitung und Förderung der Selbstständigkeit. Angehörige sind oft präsent, manchmal rund um die Uhr. Das erfordert emotionale Stabilität und ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit.
Therapie statt Verwahrung
Was viele nicht wissen: Einrichtungen mit junger Pflege beschäftigen eigene Therapeut:innen – Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie. Bewohner:innen erhalten täglich bis zu drei Einzelsitzungen plus Gruppenangebote. Anders als in der ambulanten Pflege gibt es keine Limitierung durch Verordnungen. Die Therapie folgt dem tatsächlichen Bedarf – mit sichtbarem Erfolg: Menschen im Wachkoma wachen auf, andere kehren zurück in den Beruf oder in die Familie.
„Das übergreifende Arbeiten zwischen Pflege, Betreuung und Therapie bringt so viel mehr Miteinander. Das ist ein echter Unterschied zur Altenpflege.“ – Anja Woltery
Ein anderer Ort, eine andere Kultur
Von der Raumgestaltung über Essenszeiten bis hin zu Freizeitangeboten: Alles ist anders als in klassischen Pflegeeinrichtungen. Die Zimmer sind individuell eingerichtet, es gibt Fitnessräume, ein eigenes Café, Rückzugsräume für Therapie. Bewohner:innen gestalten ihr Umfeld mit – auch mit Blick auf Sexualität oder Partnerschaft. Diese Themen tauchen in der jungen Pflege ganz selbstverständlich auf und fordern neue Lösungen, etwa bei der Gesundheitsfürsorge.
Psychosoziale Begleitung: Auch die Angehörigen brauchen Hilfe
Eltern, Partner:innen, Kinder sie alle sind mitbetroffen. Der Alltag verändert sich radikal, Beziehungen stehen unter Druck, manche zerbrechen. Einrichtungen, die junge Pflege anbieten, setzen deshalb auf psychosoziale Unterstützung. Sozialarbeiter:innen, Psycholog:innen und externe Beratungsstellen begleiten die Familien. Denn es geht nicht nur um medizinische Versorgung, sondern auch um soziale Teilhabe und emotionale Stabilität.
Junge Pflege ist keine Reha und kein Altenheim
Gerade Kliniken und Rehazentren sind oft überfordert, wenn es um Anschlussversorgung geht. Doch nicht jeder junge Mensch passt in eine junge Pflegeeinrichtung. Die Teams müssen differenzieren zwischen neurologischer Pflegebedürftigkeit und psychiatrischem oder suchtbedingtem Unterstützungsbedarf. Für Letztere gibt es bislang kaum passende Angebote – ein dringender Handlungsauftrag an Politik und Gesellschaft.
Auswirkungen auf das Berufsbild Pflege
Die Anforderungen in der jungen Pflege verändern auch die Zusammensetzung der Teams. Neben Altenpfleger:innen arbeiten zunehmend Gesundheits- und Krankenpfleger:innen sowie Therapeut:innen. Der generalistische Abschluss gewinnt hier an Bedeutung, weil die Versorgungsrealität nicht in starren Kategorien funktioniert. Hinzu kommt: Die Arbeit ist oft erfüllender. Pflegefachpersonen erleben spürbare Fortschritte, haben mehr Zeit und erhalten durch die enge Begleitung eine tiefere Bindung zu den Bewohner:innen.
Gute Pflege braucht Struktur und Personal
Ein hoher Betreuungsschlüssel ist essenziell für die Qualität. In der jungen Pflege ist dieser Schlüssel deutlich besser als in der klassischen Altenhilfe. Während Pflegefachpersonen in vielen Einrichtungen acht bis zehn Bewohner:innen versorgen, liegt die Quote hier bei vier. Das ermöglicht nicht nur mehr Pflegezeit, sondern auch spontane Ausflüge, persönliche Betreuung und gemeinsame Aktivitäten ohne dass andere Aufgaben leiden.
Perspektive: Wachsende Bedeutung bei knappen Ressourcen
Die demografische Entwicklung stellt das System vor doppelte Herausforderungen: Mehr alte, aber auch mehr junge Menschen sind auf Pflege angewiesen. Einrichtungen wie die beschriebene reagieren mit Innovationen. Schon jetzt entstehen neue Konzepte, mehr Plätze, differenziertere Angebote – etwa für junge Menschen mit Suchthintergrund oder psychischer Erkrankung. Dabei bleibt das Grundprinzip erhalten: Pflege bedeutet nicht Aufbewahrung, sondern Teilhabe und Lebensqualität.
Veranstaltungen
Bereits zum vierten Mal laden wir in diesem Sommer zu unserem Train the Trainer für empCARE ein. empCARE ist das wissenschaftlich evaluierte Präventionskonzept für Pflege- und Sozialberufe.
Einige Bildungseinrichtungen haben es bereits fest in ihre Ausbildungen oder Fachweiterbildungen integriert. Zahlreiche Einrichtungen arbeiten mit unseren freiberuflichen Trainier*innen zusammen und nutzen empCARE im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Wir freuen uns auf weitere interessierte Kolleg*innen, die ihre Kompetenzen in der Gesundheitsförderung, der Beziehungsarbeit und in der interaktiven Didaktik erweitern wollen.
Was ist deine Meinung zur Fortbildungsordnung Rheinland-Pfalz?