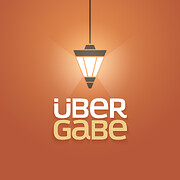Moralischer Distress in der Intensivpflege: Erkenntnisse aus der MIND-Studie
Moralischer Distress ist ein Begriff, der bislang nur in wenigen Einrichtungen ernsthaft thematisiert wird. Dabei beschreibt er ein zentrales Problem in der pflegerischen Versorgung – insbesondere auf Intensivstationen. Die Pflegefachpersonen dort sind täglich mit Situationen konfrontiert, in denen sie wissen, was zu tun wäre, dies aber aus strukturellen oder hierarchischen Gründen nicht umsetzen können. Dieser Zustand hinterlässt Spuren: psychisch, emotional und körperlich. Die MIND-Studie (Moralischer Distress unter Intensivpflegepersonen in Deutschland) schließt hier eine wichtige Forschungslücke.
Was ist moralischer Distress?
Moralischer Distress ist kein Alltagsstress. Er entsteht dann, wenn Pflegefachpersonen moralisch wissen, was richtig wäre, dies aber aus institutionellen Gründen nicht tun können. Anders als allgemeiner Arbeitsstress, bei dem Überforderung oder Reizüberflutung im Vordergrund stehen, geht es hier um eine tiefer liegende Diskrepanz zwischen Wollen und Dürfen. Die betroffene Person erlebt eine ethisch aufgeladene Situation, die mit dem eigenen Berufsethos kollidiert.
Die Folge: Schuldgefühle, Frustration, Zorn, ein sinkendes Selbstwertgefühl und sogar psychosomatische Beschwerden. Das Thema ist dabei keineswegs neu – der Begriff wurde bereits 1984 von Andrew Jameton geprägt – aber in Deutschland fehlt bislang ein valides Instrument zur Erfassung. Genau hier setzt die MIND-Studie an.

Die Idee zur MIND-Studie
Larissa Forster, Pflegewissenschaftlerin und Studiengangskoordinatorin an der Universität Freiburg, führt die MIND-Studie im Rahmen ihrer Promotion durch. Ihr Ziel: Den moralischen Distress messbar machen und langfristig zur Entwicklung von Interventionen beitragen. Der Ausgangspunkt war klar: Die Belastung von Intensivpflegepersonen ist hoch, doch bisher fehlten valide Daten, wie moralischer Distress entsteht, sich auswirkt und gemessen werden kann.
Ein großer Teil ihrer Arbeit bestand darin, ein bestehendes, international validiertes Instrument – den "Measure of Moral Distress for Healthcare Professionals" (MMD-HP) – zu übersetzen und für den deutschen Sprach- und Kulturraum anzupassen.
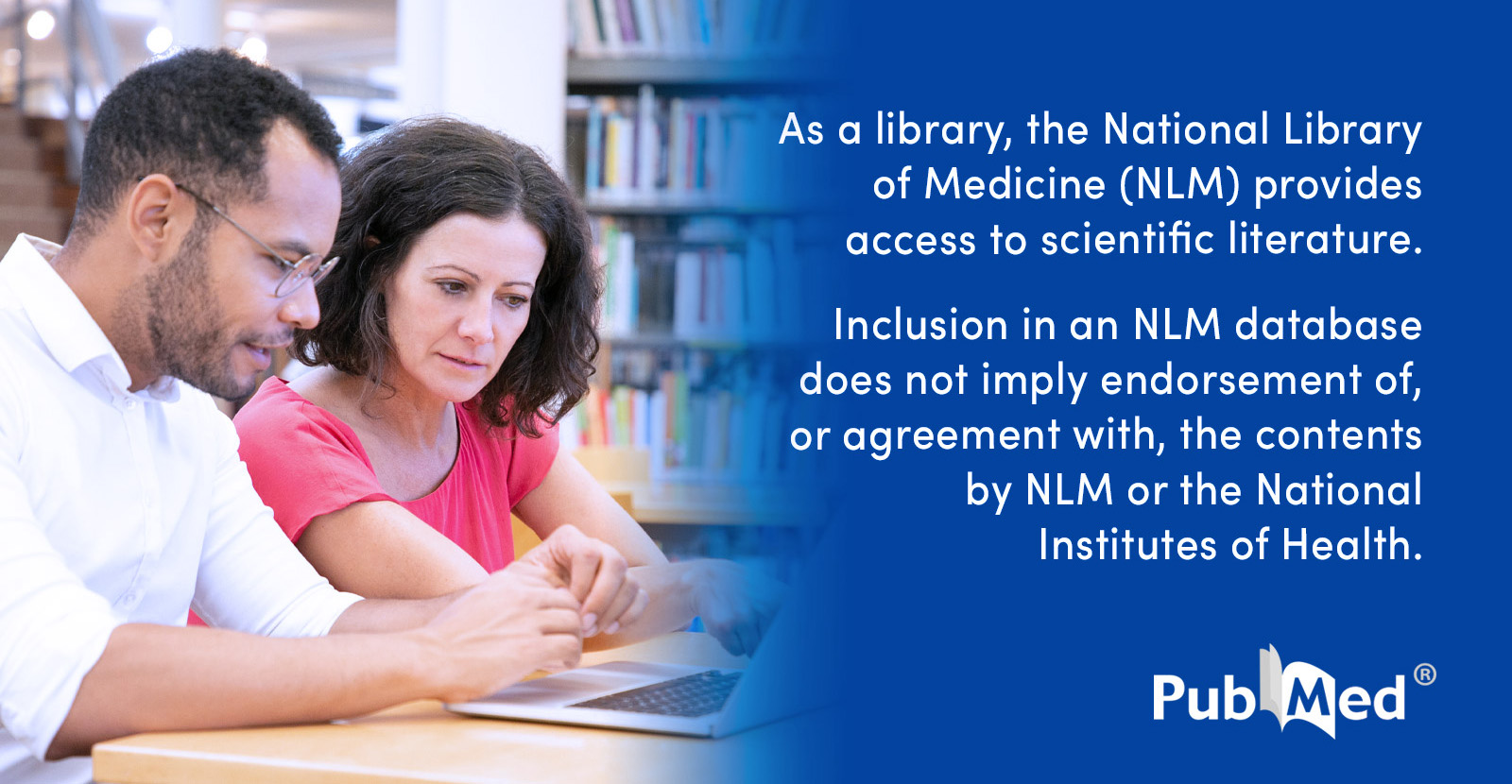
Warum überhaupt ein neues Instrument?
Pflege ist nicht überall gleich. In den USA haben Pflegefachpersonen andere Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse als in Deutschland. Deshalb konnte das Originalinstrument nicht einfach übersetzt werden. Der Übersetzungsprozess erfolgte streng wissenschaftlich nach standardisierten Leitlinien: mit Vorwärts- und Rückübersetzungen, kognitiven Pretests und Expert:innenfeedback. Zwei Items mussten dabei entfernt werden, weil sie sprachlich oder inhaltlich nicht auf den deutschen Kontext passten.
Das Ergebnis: Eine erste deutsche Version des MMD-HP mit 25 Items, die sowohl Häufigkeit als auch Belastungsgrad bestimmter Situationen erfasst.
Wie funktioniert das Instrument?
Jedes Item beschreibt eine konkrete pflegerische Situation, die moralischen Distress auslösen kann. Die befragte Pflegefachperson bewertet für jedes Item auf einer Skala von 0 bis 4, wie häufig sie diese Situation erlebt hat und wie belastend sie war. Aus beiden Angaben wird ein Summenwert berechnet, der insgesamt zwischen 0 und 432 liegen kann. Bei der Übersetzung fielen zwei Items weg, sodass der maximale Wert bei 400 liegt.
In der Pilotstudie lag der durchschnittliche Score bei 106 – moderat, aber keineswegs unbedenklich. Der niedrigste Wert lag bei 3, der höchste bei 325. Das heißt: Einige Pflegefachpersonen erleben kaum moralischen Distress, andere hingegen massiv.
Wer war beteiligt?
An der Pilotierung nahmen 187 Pflegefachpersonen von zwei Standorten teil. Fast die Hälfte hatte eine Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesiepflege. Das Durchschnittsalter lag bei 38 Jahren, der Frauenanteil bei 81 Prozent. Die meisten arbeiteten schon 13 Jahre in der Intensivpflege. Das zeigt: Moralischer Distress betrifft keineswegs nur Berufseinsteiger:innen.
Woran liegt's? Strukturelle Ursachen im Fokus
Die MIND-Studie erfasst neben den psychischen Auswirkungen auch strukturelle Faktoren und die zeigen ein klares Bild: Zu wenig Personal, Zeitmangel und hierarchische Hürden sind die Haupttreiber von moralischem Distress. In den USA wurden diese Faktoren bereits in das Instrument integriert, und auch in der deutschen Version zeigen sie sich als zentrale Belastungsquellen.
Larissa nennt Beispiele: Pflegefachpersonen möchten Gespräche führen, Beratung leisten, mehr Zeit mit Patient:innen verbringen, doch der Arbeitsalltag lässt das nicht zu. Das führt zu einem Verlust moralischer Integrität und auf Dauer zu einem Zustand, den man als "Empathieerschöpfung" bezeichnet.
Empathieerschöpfung: Wenn Mitgefühl verloren geht
Der Begriff beschreibt das, was passiert, wenn Pflegefachpersonen emotional abstumpfen. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Um sich selbst zu schützen, reduzieren sie ihre Pflege auf das Nötigste. Andere reagieren mit übertriebener Fürsorge. Beide Verhaltensweisen zeigen: Hier ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten.
"Empathieerschöpfung führt dazu, dass Pflegefachpersonen den Kontakt zu Patient:innen meiden oder Pflege auf einen mechanischen Akt reduzieren." - Larissa Forster
Die Konsequenz: Burnout, psychische Erkrankungen, Berufsausstieg. Und das nicht, weil Pflegefachpersonen nicht belastbar sind, sondern weil das System sie überlastet.
Was heißt das für die Praxis?
Die Studie liefert erste belastbare Zahlen für Deutschland. Und sie zeigt: Moralischer Distress ist messbar und real. Der nächste Schritt ist nun, Interventionen zu entwickeln. Larissa nennt mögliche Ansätze:
- Supervision: Einzel- oder Gruppensettings, um belastende Situationen zu reflektieren.
- Ethikcafés oder Ethikkomitees: Orte für strukturierten Austausch.
- Stärkung moralischer Resilienz: Achtsamkeit, Grenzen erkennen, Selbstpflege.
- Teamkommunikation verbessern: Regelmäßiger Austausch, flache Hierarchien.
- Integration in Fort- und Weiterbildungen: Ethik nicht nur lehren, sondern praktizieren.
Diese Ansätze setzen sowohl bei der Person als auch bei der Organisation an. Denn moralischer Distress ist kein individuelles Problem, sondern ein strukturelles.
Und was kommt jetzt?
Die nationale Erhebung, Phase 3 der MIND-Studie, ist abgeschlossen. Mehr als 400 Pflegefachpersonen haben teilgenommen. Die Auswertung läuft. Ziel ist es, die Daten zu veröffentlichen, die deutschsprachige Version des MMD-HP zugänglich zu machen und später auch gezielte Interventionen zu entwickeln.
Larissa Forster wird ihre Ergebnisse auf dem Pflegesymposium der Uniklinik Freiburg vorstellen. Schon jetzt zeigen viele Einrichtungen Interesse. Der Bedarf ist da.
Warum das Thema jetzt wichtig ist
Pflegefachpersonen sind das Rückgrat des Gesundheitssystems. Wenn sie durch moralischen Distress belastet werden, hat das Folgen: für sie selbst, für Kolleg:innen, für Patient:innen. Die MIND-Studie macht sichtbar, was lange unsichtbar war. Und sie legt den Grundstein für Veränderung.
Denn wer weiß, woran es liegt, kann auch etwas dagegen tun.
Deine Abschlussarbeit im Übergabe-Podcast?
Larissas Beitrag zeigt eindrucksvoll, welchen Wert wissenschaftliche Arbeiten für die Pflegepraxis haben können – und wie wichtig es ist, diese sichtbar zu machen. Genau deshalb öffnen wir im Übergabe-Podcast regelmäßig den Raum für Qualifikationsarbeiten aus der Pflege und dem Gesundheitswesen: Bachelor-, Master- oder Promotionsprojekte, die etwas bewegen wollen.
Wenn du selbst eine spannende Abschlussarbeit geschrieben hast oder gerade daran arbeitest und Lust hast, sie im Podcast vorzustellen: Meld dich gern bei uns! Schreib einfach eine kurze Nachricht über uebergabe.de oder direkt in unserer Community.
Wir freuen uns auf deine Idee.
Diskutiere wichtige Themen der Pflege in unserer Community: